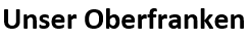Im Mehrgenerationenhaus Kulmbach begegnen sich Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft. Die Geschwister-Gummi Stiftung hat das für die Region beispielgebende Projekt initiiert. Auch nach sechs Jahren als Leiterin der Einrichtung, gibt es noch Momente, die Elsbeth Oberhammer begeistern.
In welchen Momenten sind Sie besonders dankbar für Ihren Beruf?
Wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin Ikram [Besucherin des Mehrgenerationenhauses, Anmerkung der Redaktion] im Schnee spazieren gehe und sie sich so darüber freut, wie sehr der Schnee glitzert. Das ist einfach schön!
Waren Gemeinschaftserlebnisse wie dieses schon immer der Kern der Geschwister-Gummi-Stiftung?
Die Geschwister Gummi haben vor etwa 150 Jahren eine Stiftung zur Pflege von evangelischen Waisenkindern gegründet. Das erste evangelische Waisenhaus stand auch tatsächlich am Holzmarkt in Kulmbach und musste nach einigen Jahren erweitert werden. 1907 konnte dieses Haus hier eröffnet und bezogen werden. Damals auf der grünen Wiese vor den Toren der Stadt.
Jetzt sind wir natürlich mittendrin! Vor etwa 25 Jahren ist das Kinderheim dann hier ausgezogen, weil die Bestimmungen sich verändert haben. Dadurch wurde Platz für neue Ideen.
Wie hat sich das Projekt weiterentwickelt?
Wir wollten wieder was für Familien und Kinder verwirklichen. Also starteten wir mit dem familienfreundlichen Café. Hier treffen sich junge Familien und Mütter, um sich auszutauschen. Die Kinder können hier krabbeln, spielen und laut sein – und niemand stört sich daran. Und dann sind nach und nach die anderen Angebote ins Haus eingezogen.
Welche sind das konkret?
Wir haben für viele Generationen ein Angebot. Wer handwerklich begeistert ist, gerne einen aktiven Ruhestand genießen möchte, kann sich in unserer professionell ausgestatteten Schreinerwerkstatt engagieren. Oder einen Schnitzkurs besuchen, sich von unseren Profis was zeigen lassen. Alle Werkstatt-Mitarbeiter basteln und werkeln regelmäßig – aktuell für unseren Weihnachtsmarkt zum Beispiel.
In unserem Fairtrade-Café kommt man bei Kaffee und Kuchen gut miteinander ins Gespräch. Auch ehrenamtliches Engagement ist hier möglich: Als Sprachpate, Lernpate oder in unserem KuKaTz-Secondhand-Laden. Dort gibt es Babyausstattung, Spielsachen oder auch Klamotten für Kinder und Erwachsene zu einem kleinen Preis.
Und im zweiten Stock ist unser Bildungsangebot. Musikgruppen für Kinder und für Mütter Sprach- und Sportkurse, wie etwa Pilates oder Rückbildung. Insgesamt ist also für jeden was dabei!

Welches Ziel verfolgen Sie mit dem Mehrgenerationenhaus?
Meinen Auftrag sehe ich darin, für junge Familien ein adäquates Angebot zusammenzustellen und immer im Blick zu haben: Was brauchen unsere Familien im Moment? Das ist sehr spannend, weil sich das ständig verändert.
Der andere Schwerpunkt dieses Hauses speziell ist das Thema Migration, Arbeit mit Geflüchteten. Da gibt es die Sprachpaten-Angebote und die Frauengruppe. Hier treffen sich arabische Frauen seit mehreren Jahren und sind unglaublich aktiv. Damit konnten wir einen guten Beitrag leisten, dass die Frauen und ihre Familien sich gut hier integrieren konnten.
Nun gibt es ja leider immer wieder kritische Stimmen aus der Bevölkerung, was die geflüchteten Menschen angeht. Was entgegnen Sie diesen Kritikern?
Ich würde ihnen mitgeben, dass wir uns an unsere eigene deutsche Geschichte erinnern. Auch bei uns gibt es viele Menschen mit Fluchterfahrungen. Unser Besuch im Seniorenheim fand ich sehr beeindruckend. Die Senioren und Seniorinnen haben dort sehr bewegt von ihren eigenen Fluchterfahrungen erzählt und zu den geflüchteten Frauen gesagt: „Wir wissen, wie’s euch geht.“ Ich denke das tut unserer mittleren und jüngeren Generation ganz gut, da mal auf die eigenen Großeltern zu hören, die haben da manchmal mehr Empathie.
Wenn man sieht, welchen Weg die Geflüchteten genommen haben und wie gut sie sich integriert haben, dann macht das Mut. Wir dürfen sie nicht alleine lassen. Müssen sie gut begleiten. Unsere Welt erklären. Und nicht voraussetzen, dass unsere Welt sich selbst erklärt.
Und es ist eine Chance! Bei uns fehlen so viele Arbeitskräfte. Da sage ich: Die Geflüchteten kommen doch wie gerufen. Wir brauchen sie ganz einfach.
Ihr Beruf klingt wahnsinnig komplex. Bei all den unterschiedlichen Projekten, wie motivieren Sie sich täglich aufs Neue?
Ich empfinde die Vielfalt der Menschen hier als sehr bereichernd. Die engagierten Ehrenamtlichen, die Arbeit mit älteren Menschen, zu sehen, dass ich einer jungen geflüchteten Familie weiterhelfen konnte. Das erweitert meinen Horizont immer wieder.
Oder die Selbsthilfegruppen. Seit einigen Jahren treffen sich hier Eltern von Kindern mit Autismus-Asperger-Syndrom oder anderen Beeinträchtigungen. Den Perspektivwechsel von der Seite der Erzieherin zum Blickwinkel der Betroffenen finde ich wahnsinnig wertvoll. Zu sehen mit welchen Hindernissen und Vorurteilen die Familien zu kämpfen haben, konnte ich mir zuvor nur schwer vorstellen. Und da auch mitzuhelfen, dass bei Institutionen, Einrichtungen und Behörden mal mehr der Gedanke entsteht: Wir sind eigentlich dafür da die Familien zu unterstützen, ihnen zu helfen. Und nicht zusätzliche Hürden aufzubauen und die Familien als Bittsteller kommen zu lassen.
Welche Hürden werden den Familien da beispielsweise gestellt?
Eine Familie mit einem an Trisomie 21 erkrankten Kind musste etwa jährlich einen Bogen ausfüllen, dass diese Behinderung noch besteht. Das ist fast beleidigend für die Familie, denn sie wünschen sich ja nichts sehnlicher, als dass sich die Erkrankung einfach in Luft auflöst. Oder die Einrichtungen und Schulen lassen durchblicken, dass das Kind sehr anstrengend für den eigenen Betrieb ist. Statt zu fragen „Was braucht ihr von uns? Wie können wir euch helfen?“, wird kommuniziert „Das erwarte ich von Ihnen.“ Ich wünsche mir wirklich, dass es da in vielen Köpfen noch ein Umdenken gibt.