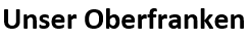Wasser ist zum Waschen da – das gilt in der Bierhauptstadt Kulmbach besonders. Neu ist dort allerdings, dass schon das Wasser allein zum Sauberwerden reicht.

„Es ist, wie es immer ist, und alles ganz einfach.“ Was ein bisschen schlicht klingt, beschreibt eine Kulmbacher Firma, die weder das Eine, noch das Andere ist, denn Caroline Schuberth macht die Dinge weder „wie immer“ noch „einfach“. Aber sie kann beides: Lakonisch und leidenschaftlich, London und lokal.
Und „lokal“, das heißt in diesem Fall Oberfranken, präziser Kulmbach. Denn hierher kehrte die studierte Marketing-Fachbereich nach Stationen bei Großbanken in Frankfurt und London zurück, mit der Idee, ihre Aufgabe daraus mitzunehmen, nicht aber die Zwänge und Einschränkungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
„London ist toll, wenn man Single ist“
Das war vor vor als einem Jahrzehnt, wenn Caroline Schuberth heute über Kulmbach spricht, dann klingt das warm, selbstverständlich, so wie jemand spricht, der genau weiß, wo er hingehört. „Ich bin selbst sehr ländlich aufgewachsen, und genau das wollte ich für meine Kinder auch“, sagt sie, mit Blick zurück auf eine Zeit in gläsernen Banktowern an Main und Themse.
Da die Kinder schon mehr oder weniger konkretes Ziel waren, und die Banken ihre fähige Marketingmitarbeiterin auch in einer Zeit nicht verlieren wollten, in der remote, in der Provinz sitzen und Life-Work-Balance in der konservativen Finanzbranche noch nicht selbstverständlich waren, packte Caroline ihre Koffer und kehrte zurück nach Oberfranken.
Agenturstart mit gefülltem Auftragsbuch
Im Gepäck nicht nur britische Souveniers, sondern vor allem einen bereits gefülltes Auftragsbuch, das den Start der eigenen Agentur – „Essence“ gibt es auch heute noch – sehr erleichterte. Von da an funktionierte vieles nach Plan, die Kinder kamen und wuchsen im beschaulichen Kulmbach auf, sicher, behütet, auf kurzen und vertrauten Wegen.
Doch dann – Caroline dazu „Es ist, wie es immer ist“ – war es die Abweichung von der Norm, das Spezialding, das dafür sorgte, dass die Unternehmerin die nächste Kurve in Richtung Innovation gelang: Die 2015 geborene Tochter litt an Neurodermitis – und zur Überraschung der Mutter herrschte ein Mangel an tauglichen Textilien.
„Es kann doch nicht sein, dass es so etwas nicht gibt!“
Doch der währte nicht lang, denn durch die Verbindnung von Weber-Know-how – die Großmutter war vom Fach – Bedarf und Unternehmergeist enstanden kurz darauf die „waschies“: Ursprünglich Waschlappen, auf eine besondere Weise aus speziellen Fasern gewebt, hochfunktonional und hygiensich, da auf 95 Grad waschbar.
Eigentlich als Sonderanfertigung für den Privatgebrauch gedacht, ließ die Größenordnung – 300 Meter Mindestabnahmemenge seitens der Weberei – dies nicht zu, für Caroline Schuberth, keine Frage: „Da machen wir was draus.“
Heute, einige Jahre später, beschäftigt die waschies GmbH in Kulmbach acht Mitarbeitende, arbeitet nach viel Entwicklungs- und Marketingaufwand inzwischen kostendeckend und ist auf Expansionskurs.
Von Kulmbach in die Welt
So gibt es waschies inzwischen nicht mehr nur als Waschlappen, sondern auch als wieder verwendbare Abschminkpads, als Auftragepads und in diversen Variationen und Formen. Fast ebenso bunt ist die Produkte ist die Kundschaft: junge Frauen und Kinder, Hebammen und Pflegekräfte.
 Der Vertrieb funktioniert weitestgehend online, über die sozialen Medien, doch auch in Kulmbach gibt es seit einiger Zeit ein Ladengeschäft. Es ist mehr Showroom als Umsatzbringer, öfter Videokulisse als Verkaufstresen, eher Fotostudio als Fachgeschäft.
Der Vertrieb funktioniert weitestgehend online, über die sozialen Medien, doch auch in Kulmbach gibt es seit einiger Zeit ein Ladengeschäft. Es ist mehr Showroom als Umsatzbringer, öfter Videokulisse als Verkaufstresen, eher Fotostudio als Fachgeschäft.
Hier trifft man Caroline Schuberth, wenn sie zwischen Instastory-Dreh und Korea-Telefonat, von Kamerafrau zu Paketboten, vom Showwaschbecken zum Schreibtisch wirbelt. Denn sie hat noch eine ganze Menge vor, die Frau aus Kulmbach, die die weite Welt kennt, Bier trinkt, und sich mit Wasser nur wäscht.