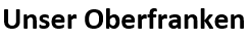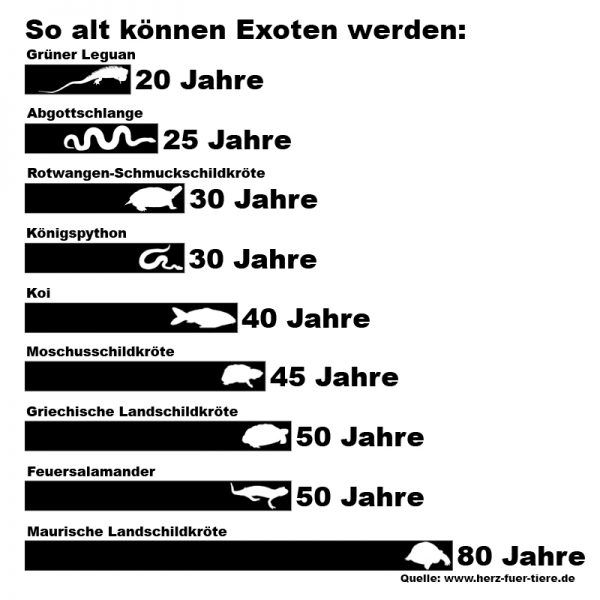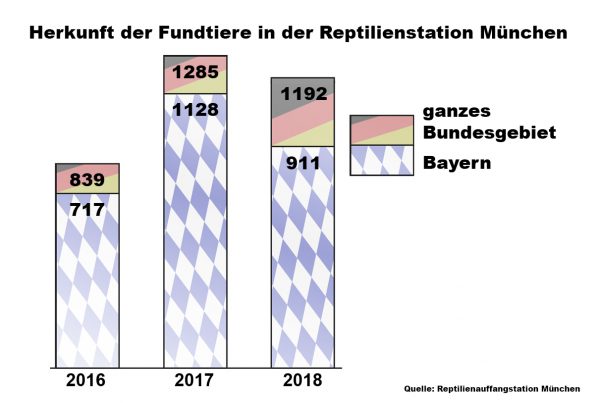Zunächst einmal sei ein Waldkindergarten ein ganz normaler Kindergarten, erklärt Diplom-Pädagogin Stefanie Baumann, Leiterin der Einrichtung. Auch er sei an das bayrische Kindertagesstättengesetz gebunden. Der Unterschied besteht nur darin, dass die Kinder mit ihren ErzieherInnen eben täglich und bei jedem Wetter draußen im Wald unterwegs sind. Bei „Die kleinen Waldschrate e.V.“ handle es sich um einen „kleinen, familiären Verein“, erzählt sie weiter, der sich anfallende Aufgaben teilt. Wie die meisten Einrichtungen dieser Art besitzen auch „Die Kleinen Waldschrate e.V.“ eine Hütte, in die sie sich bei Regen zurückziehen können. Sie liegt im Bruderwald verborgen zwischen dem Naturwaldreservat „Wolfsruhe“ und dem Klinikum Bamberg.
Der Kindergarten-Alltag
Jeden Morgen läuft die heute 20-köpfige Kindergruppe mit ihren Erziehern den 1,5 km langen Weg vom Eingang des Waldes bis zu der kleinen Lichtung, auf der sich die Hütte befindet. Diese ist bereits vom eingebauten Ofen vorgeheizt, wenn die Kinder nach einstündiger Wanderung zum Frühstück erscheinen. Dann gibt es eine Brotzeit mit Nüssen oder Trockenfrüchten und je nach Jahreszeit auch saisonales Obst und Gemüse.
Die Stromversorgung der Hütte wird durch Solarpanels auf dem Dach gesichert, die eine ausreichende Beleuchtung gewährleisten. „Wir möchten Umwelterziehung auch vorleben“, erklärt Stefanie Baumann. Deshalb wird bei der Wasserversorgung auf Kanister zurückgegriffen, für Wärme sorgt der zentrale Ofen und auf Plastik wird weitestgehend verzichtet. „Weniger kann manchmal mehr sein“, sagt sie. Und dies gilt auch beim Spielen: Wer braucht schon Lego, wenn er mit echten Steinen spielen kann? Wozu Plastikschwerter, wenn es auch mit Stöcken geht? In und in unmittelbarer Nähe der Hütte filzen, schnitzen und basteln die „kleinen Waldschrate“ unter Anleitung.
Über die Verbindung zur Natur
Die Lebenssituation von Kindern sieht heute oft anders aus. Für viele ist sie bestimmt von Reizüberflutung, Bewegungsmangel, funktionellem Spielzeug und geregeltem Freizeitangebot.1 Wald- und Naturkindergärten möchten diesen Umständen mit erlebnis- und beschäftigungsspezifischen Anreizen entgegenwirken.
Dass die Kleinen im Kindergarten keine vorgefertigten Spielwaren vorfinden, fördert in diesem Sinne ihre Kreativität. Auch sind sie so gezwungen, sich untereinander abzusprechen, was die Sozialkompetenzen des Einzelnen und der Gruppe verbessert. Gruppenzugehörigkeit kann wiederum zu einer entspannten Lernatmosphäre beitragen. In einer Zeit, in der viel von „Mobbing“ und „Ellenbogen-Einsatz“ geredet wird, werden diese sozialen Ansätze immer wichtiger.1 „Wir sind ja keine autarken Lebewesen“, verdeutlicht Stefanie Baumann, „wir sind Teil dieser Erde und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit und nicht ohne Mutter Natur aufwachsen“.
Umweltbewusstes Denken ist heute mehr denn je gefragt – doch ist Grundlage dafür, dass man die Natur auch kennt. In diesem Sinn jedenfalls hält Hartmut von Hentig fest: „Wenn ein Kind nie einen Samen gesät, die daraus entstehende Pflanze entdeckt und gehegt hat, wenn es nie einen Baum bestiegen, nie einen Bach gestaut, nie ein gefährdendes Feuer gemacht hat … – wie soll ihm die Erhaltung der Arten, das ökologische Gleichgewicht, die ‚Natur‘, diese ungeheuerlichste Abstraktion aller Abstraktionen, am Herzen liegen“ 2.
Entdeckergeist schulen
Die Erzieher des Waldkindergartens lassen ihre Schützlinge diese „ungeheuerlichste Abstraktion“2 weitgehend selbständig erforschen und entdecken. Darin folgt das pädagogische Konzept den Erkenntnissen des Neurobiologen Prof. Dr. Gerald Hüther, der ideale Lernbedingungen dann gegeben sieht, wenn Kinder ihre angeborene Lust am Entdecken und Gestalten nicht verlieren. 3
„Natürlich geben wir dennoch Impulse und beobachten“, erklärt Stefanie Baumann, „und es ist immer schön anzusehen, wenn Kinder ihre Scheu ablegen, mit ihren roten Wangen in Gummistiefeln durch den Wald laufen, mit ihren Wassereimern und Stöcken – es ist so schön zu sehen, wofür Kinder sich begeistern können und es ist so schade, dass viele Erwachsene das vergessen haben“.
Was für ein Regelkindergartenkind Lego ist, sind für das Waldkindergartenkind Stöcke und Steine. Damit kommt es der Natur in jungen Jahren schon ein ganzes Stück näher. In Waldkindergärten sollen Kinder durch diese Art der Begegnung schon früh lernen, sich als konstruktiver Teil ihrer Umwelt wahrzunehmen. Der Kindergarten „Die kleinen Waldschrate e.V.“ aus Bamberg, der im Jahr 2005 durch eine Elterninitiative ins Leben gerufen wurde, setzt sich für frühe Naturverbundenheit als Basis einer nachhaltigen Entwicklung ein.

Für mehr Informationen: https://www.waldkindergarten-bamberg.de/
(1) Dr. phil. Häfner, Peter: „Natur- und Waldkindergärten in Deutschland – eine Alternative zum Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehung“, Diss. 2008, Universität Heidelberg, S. 35ff.
(2) HENTIG, H. VON: Humanisierung, eine verschämte Rückkehr zur Pädagogik? Stuttgart 1993, S. 56, zit. nach Dr. phil. Häfner, Peter: „Natur- und Waldkindergärten in Deutschland – eine Alternative zum Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehung“, Diss. 2008, Universität Heidelberg, S. 40.
(3) Vgl. BildungsklickTV: „‚Begeisterte Entdecker bleiben‘ – Interview mit Prof. Dr. Gerald Hüther“, URL: https://www.youtube.com/watch?v=Sdf1_k0UO3w [letzter Aufruf am 22.03.2020].
Wer sich für das Thema „Kindergarten“ interessiert, kann sich hier weiter umschauen: