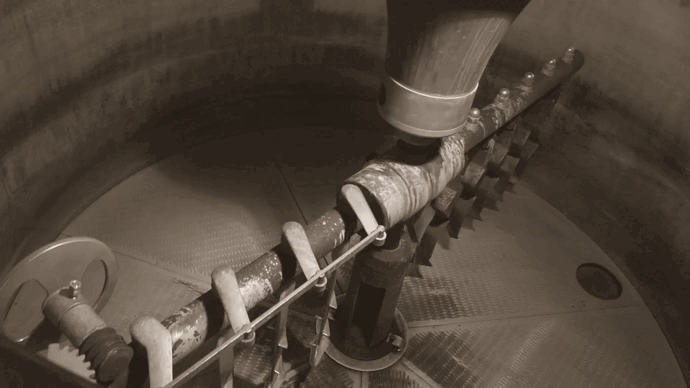Ein Interview mit Ottmar Müller

Karsten Babucke traf zu einem Gespräch Braumeister Ottmar Müller
Ich treffe mich mit dem Braumeister der Brauerei Haberstumpf in Trebgast. Die Brauerei fällt mit ihren außergewöhnlichen Flaschen und einem innovativen Konzept auf. Die Brauerei in Trebgast befindet sich in einem alten Brauhaus. Das Sudhaus besteht schon seit vielen Generationen. Hier wird das Brauen noch mit der Hand durchgeführt. Aber auch der Umstand, dass der Besitzer wechselte und das viel erneuert wird, gibt Raum für Kreativität.
KB: Was sind deine Funktionen hier in der Brauerei.
Ottmar: Also ich habe vor ziemlich genau zwei Jahren hier angefangen, als Braumeister. Und hab die schöne Aufgabe, die alte Brauerei vom Herrn Wernlein in ein neues modernes Schmuckstuck zu verwandeln. Da dazu gehört, die komplette Brauereitechnik auf den neusten Stand der Technik zu bringen, um wieder adäquat Bierbrauen zu können.
KB: Das klingt nach einem spannenden Projekt. Hier wird sich bestimmt noch viel in naher Zukunft ändern. Aber seit wann gibt es eigentlich die Brauerei in Trebgast?
Ottmar: Die Brauerei geht eigentlich auf das Jahr 1531 zurück. Sprich, wir haben bald fünfhundertjähriges Jubiläum. Die Brauerei war ursprünglich bei der Kirche. Sie ist dann irgendwann aus allen Nähten geplatzt und so hatte man sich damals entschlossen, bei den Bierkellern einen Neubau zu machen. Um das Brauen größer zu gestalten und es für die Zukunft fähig zu machen.
KB: Die Familie Haberstumpf hatte die Brauerei seit 1830 in Familienbesitz. Doch bis jetzt hat sich einiges geändert. Besonders in den letzten Jahren gab es Höhen und Tiefen.
Es gab Höhen und Tiefen, das stimmt. Der August Haberstumpf hatte einen tödlichen Unfall im Gärkeller. So kam es, dass der Hans Wernlein die Brauerei übernahm. Wie die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den zwei sind, ist mir unbekannt. Bis vor zwei Jahren hatte er die Brauerei geführt und aus Altersgründen und mangels Nachfolger musste er aufhören. Gott sei Dank hat Herr Förtsch die Brauerei aufgekauft. So kann die Brautradition hier in Trebgast weiter gehen.

KB: Das war ja ein Glücksfall, dass der Herr Förtsch die Brauerei übernommen hatte. Wie erging es der Brauerei in der Pandemie?
Also es geht der Brauerei gut bergauf. Das Thema Corona war, so blöd wie es klingt, für uns nicht gerade das Schlechteste. Weil wir im laufenden Betreib die komplette Betriebstechnik austauschen konnten. Und von daher sehen wir die Situation mit einem lachenden und weinenden Auge. Wir hatten halt mehr Zeit Erneuerungen zu machen. Für uns hat das gerade gut gepasst für die Zeit des Umbaus.
KB: Mit einem neuen Besitzer ändert sich in der Regel viel. Was bedeutet der Wandel für die Brauerei Haberstumpf genau?
Zum einen neue Biersorten und zum anderen die Brauerei technisch den neuesten Stand zu bringen. Vorher gab es die üblichen 0,5-Liter-Flaschen und ein paar Sorten. Wir haben jetzt unser Helles – unser Rubin – als Standard-Biersorte. Wir fangen jetzt noch an alle Monate ein Spezialbier zu brauen. Jetzt haben wir gerade das „Hahnzwergla“, dann kommt der „Bock“, dann ist ein „Weizen“ angedacht und alles andere werden wir dann sehen.
KB: Es besteht die Legende, dass hier in Trebgast eines der ersten Zwickel-Bier gebraut wurden, ist das richtig?
Äh ja. Das war der Vorbesitzer.
KB: Was ist das Sortiment der Brauerei Haberstumpf?
Da haben wir unser Helles, das ist unsere Hauptsorte. Dann haben wir noch das „Rubin“. Das ist ein rötliches, malzbetontes Bier. Im Winter gibt es den „Bock“ – das Doppelbock. Aktuell gibt es das bernsteinfarbenes Fest Bier. Und was es die Monate danach gibt, das verrate ich noch nicht. Das wird eine Überraschung. (Lacht)
KB: Was ist die Zukunftsvision der Brauerei?
Das Ziel ist auf jeden Fall, dass wir im regionalen Markt bleiben. Wir wollen hauptsächlich in Bierwirtschaften unser Fassbier ausschenken. Hier vor Ort wollen wir natürlich den Biergarten verschönern und erweitern. Und natürlich mit neuen Bierspezialitäten die Gäste überraschen. Das war momentan noch nicht so möglich, weil wir durch die Umbaumaßnahmen einige Rückschläge einstecken mussten. Weil Leitungen korrodiert waren. Dann hatten wir Infektionen in den Leitungen. Das haben wir jetzt alles im Griff. Jetzt kann es nur noch aufwärts gehen.
Und als kleinen Geheimtipp: Es wird in ein paar Jahren einen Whiskey geben. Der lagert schon bei uns im Felsenkeller. Das heißt wir haben dort spezielle Whiskey-Bier Sude gemacht. Die sind wie die Bierwürze nur ohne Hopfen mit Torfmalz aus der Region. Das ist spezielles Malz, das gedarrt wurde, um diesem Malz einen richtigen, kernigen moorigen Charakter zu geben.

KB: Der Whiskey gehört jetzt nicht zu den fränkischen Spezialitäten. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den Whiskey nach Oberfranken zu bringen.
Es ist überraschenderweise so, dass Deutschland mittlerweile mehr Whiskeybrennereien hat als Schottland. Und es gibt hierzulande auch immer mehr Whiskey-Liebhaber. So einen haben wir auch hier in unserem Betrieb und der kam dann auf mich zu. Also haben wir es einfach ausprobiert.
Der Ursprung im Vergleich zum Bier ist eigentlich dasselbe. Die Herstellung der Würze ist ähnlich wie beim Bier, nur dass die Stammwürze deutlich höher ist, da man viel mehr Alkohol braucht, um möglichst viel Whiskey zu bekommen.
KB: Warum soll man es nicht einfach machen?
Eben. Das ist das Schöne am Brauberuf, dass er so vielseitig ist. Wir haben mit Whiskey zu tun, mit Bier und wir haben freie Zutaten. Aus denen kann man so viel machen – verschiedene Biersorten und Whiskey. Das ist einfach super!
Als Braumeister ist es natürlich ein Glücksfall, in so ein Unternehmen zu kommen. Das man von Grund auf erneuern kann. Die Biersorten zu kreieren. Ein Team zusammen zu stellen. Das ist schon nicht alltäglich, dass man in so eine Gelegenheit kommt. Normalerweise ist man in einem Großbetrieb Abteilungsleiter im Sudhaus oder in der Abfüllerlei. Aber hier ist es immer spannend. Hier ist kein Tag gleich. Es gibt immer irgendwelche Probleme zu lösen. Und das ist genau das, was mir Spaß macht. Da gehe ich gern auf meine Arbeit.
Mehr zu dem Thema: